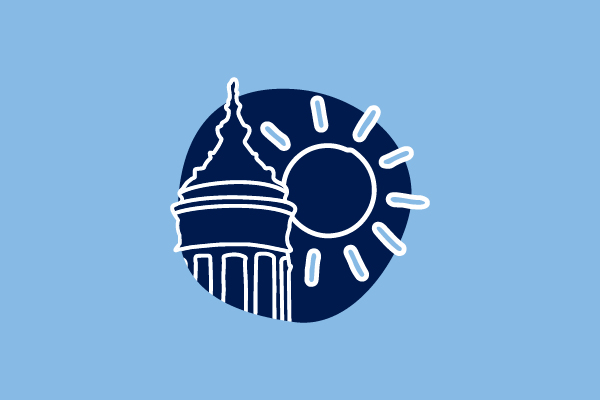Metropolregion. Photovoltaikanlagen, Windparks und Nahwärmenetze sind allgegenwärtige Keywords der Energiewende. Einen aktiven Teil zu dieser Wende beizutragen, ist für zahlreiche Mitmenschen bereits Realität. Sie sind Mitglieder von Bürgerenergiegenossenschaften, die nachhaltige und dezentrale Energieversorgungskonzepte auf regionaler Ebene vorantreiben.
Ein anschauliches Beispiel zeigt sich an der Bürgerenergiegenosschenschaft (BEG) Kurpfalz, die von 264 Mitgliedern getragen wird. Sie ist eine interkommunale Kooperation der Stadt Schwetzingen und den Gemeinden Oftersheim, Ketsch und Plankstadt. Sie gehört zu den ersten Energiegenossenschaften im Land und schaut 2025 auf mittlerweile 15 erfolgreiche Jahre zurück. Der genossenschaftliche Verbund und das damit verbundene Engagement der Bürgerinnen und Bürger für den Klima- und Umweltschutz leisten einen wesentlichen Beitrag zur kommunalen Energiewende, erklärt Martina Braun stolz. Sie ist Geschäftsführerin der Stadtwerke Schwetzingen.
„Der strategische Schwerpunkt der BEG liegt aktuell auf der Projektierung von so genannten Pachtmodellen. Diese Anlagen werden von den Stadtwerken Schwetzingen im Auftrag der BEG Kurpfalz geplant und gebaut. Die Eigentümer der jeweiligen Gebäude, hauptsächlich kommunale Schulen oder Kindergärten, pachten diese Anlagen und verwenden als Gebäudenutzer den Großteil des erzeugten Stromes für den eigenen Bedarf. „So hat beispielsweise die Anlage auf dem Dach des Schwetzinger Hebel-Gymnasiums in 2023 rund 37.000 kWh erzeugt und dabei eine Eigenverbrauchsquote von 98,3 Prozent erzielt“, fügt Braun an.
Mit rund 253.000 erzeugten Kilowattstunden aus verschiedenen Dachanlagen seien die Bilanzen für das Jahr 2024 erneut zufriedenstellend. Dazu zählen die Dachanlagen des ZWK-Wasserwerk Schwetzinger Hardt, Hebel-Gymnasium Schwetzingen, Albert-Schweitzer-Kindergarten Oftersheim, Schulsporthalle Plankstadt, Kurpfalz-Passage Schwetzingen, Schimper-Gemeinschaftsschule und Oftersheimer Rettungszentrum. Es wurde insgesamt eine Strommenge im Gesamtwert von rund 92.000 Euro erwirtschaftet. „Für die Genossenschaftsmitglieder resultiert daraus eine Dividende von um die 3,5 Prozent. Gleichzeitig hat die Stromerzeugung der verschiedenen BEG-Anlagen rund 104 Tonnen CO2 eingespart.“
Eine Strommenge im Gesamtwert dieser Summe wurde 2024 aus Dachanlagen der BEG Kurpfalz erwirtschaftet. Daraus ergibt sich eine Dividende von 3,5 Prozent für die Genossenschaftsmitglieder.
Akzeptanz der Bevölkerung für Energiewende ist spürbar groß
Auf die Frage, welche Hindernisse es hinsichtlich der Befürwortung für PV-Projekte gäbe, freut sich die BEG Kurpfalz über die Resonanz der Bürger: „Die Akzeptanz der Bevölkerung ist spürbar groß, die Warteliste für eine Mitgliedschaft in der BEG entsprechend lang. Das Thema Windpark hat für die BürgerEnergiegenossenschaft Kurpfalz angesichts der geografischen Lage in der Rheinebene und den erheblichen Investitionsvolumina bisher keine Rolle gespielt. Hier müssten gegebenenfalls die zuständigen ,politischen Akteure‘ entsprechende Überlegungen anstellen.“
Gemeinsam stark und erfolgreich geht es auch bei der Energiegenossenschaft Starkenburg zu. Als unabhängige und überparteiliche Bürgergenossenschaft fördert sie den Ausbau der Erneuerbaren Energien in der südhessischen Region Starkenburg.
Die Redaktion hat sich hierfür mit Micha Jost, Vorstandsmitglied der 2010 gegründeten Energiegenossenschaft Starkenburg, unterhalten. Die Vorteile für Bergsträßer Bürger, der Energiegenossenschaft Starkenburg beizutreten liegen auf der Hand: „Ziel unseres Zusammenschlusses ist es, den Klimaschutz mit eigenen Projekten voranzubringen, deren Finanzierung und Nutzen gleichermaßen in Bürgerhand liegt, so Micha Jost. Dabei stünden vor allem die Menschen im Vordergrund, die an den Projektorten leben oder arbeiten. „Die Energiegenossenschaft Starkenburg verbindet konkrete Klimaschutzmaßnahmen mit einem finanziellen Nutzen für Viele. 2024 wurde eine Dividende von 8 Prozent an die Mitglieder der Energiegenossenschaft Starkenburg ausgeschüttet.“
Das Projekt SolarStARK 19 demonstriert eingängig, wie sich Ideenreichtum und Kooperation sprichwörtlich auszahlt. Die Speicherung von Solarstrom erfährt zunehmende Bedeutung. Verbrauch und Erzeugung in Einklang zu bringen sind die Herausforderung der nächsten Jahre. „Vor diesem Hintergrund haben der TV Büttelborn und die Energiegenossenschaft Starkenburg das Projekt SolarSTARK 19 um einen Stromspeicher erweitert. Damit beginnt unser erster Versuch mit einem PV-Speicherbetrieb.
Der TV Büttelborn ist als Standort ideal, da in der Sporthalle besonders in den Abendstunden viel Strom benötigt wird. Seit Mitte Dezember wird dort eine Batterie mit einer Kapazität von 28 kWh eingesetzt, um überschüssigen Sonnenstrom der 99 kWp-Anlage für die Nacht zu speichern. Dadurch kann der Eigenstromanteil des Vereins jährlich um ca. 8.000 kWh erhöht werden, was einer Verdopplung entspricht. Durch den Speicher lassen sich jährlich zusätzlich vier Tonnen CO2 einsparen.“
Zusammenschluss von Energiegenossenschaften mit dem Kraichgau und Heidelberg
Die Bürgerenergiegenossenschaft Starkenburg beteiligt sich ebenfalls am Gemeinschaftsprojekt „Bürgerwindpark Lammerskopf“. Dafür hat sie sich mit der Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau und der Heidelberger Energiegenossenschaft zusammengeschlossen. Gemeinsam mit den Stadtwerken Heidelberg und dem deutschen Stadtwerkeverbund Trianel soll das Großprojekt nahe bei Heidelberg umgesetzt werden.
Die gemeinsame Stärke dabei sei die regionale Verbundenheit. Das Vorhaben soll die Wärmewende in Heidelberg voranbringen. Der Windstrom wird später über Großwärmepumpen in „Grüne Wärme“ verwandelt und damit für das Fernwärmenetz nutzbar.
Jost zeigt sich zufrieden: „Nicht nur der Klimaschutz und die Versorgungssicherheit werden von diesem Vorhaben profitieren. Die Bürgerinnen und Bürger aus dem Projektumfeld werden an den finanziellen Vorteilen durch die Erzeugung von Erneuerbaren Energien beteiligt.“
Die Energiegenossenschaft Starkenburg verfügt mittlerweile über 14 Jahre Erfahrung bei Finanzierung und dem Betrieb von Bürgerwindrädern. Es hätte sich gezeigt, dass sowohl im Zeitraum der Planung und Projektentwicklung, aber auch beim Betrieb der Anlagen eine starke Bürgerbeteiligung die Akzeptanz in der Bevölkerung maßgeblich fördert.
Steuerung über das „Zwiebelschalenprinzip“
Micha Jost erklärt die Herangehensweise so: „Ziel ist es die Bürger bestmöglich an den finanziellen Erträgen von Windrädern zu beteiligen. Unsere bisherigen wurden daher mit einem branchenunüblich hohen Eigenkapitalanteil finanziert (durchschnittlich über 50 Prozent). Über das ,Zwiebelschalenprinzip‘ lässt sich der Kreis der Beteiligten exakt steuern. Zunächst wird den Menschen im direkten Projektumfeld eine finanzielle Beteiligung ermöglicht. Je nach Interesse und erforderlichem Finanzierungsvolumen wird der Personenkreis dann in die Region hinaus ausgedehnt. Dieses Verfahren hat sich außerordentlich bewährt und sorgt für eine größtmögliche Wertschöpfung am Projektort.“
„Die größten Herausforderungen bei der Projektentwicklung liegen nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, bei Ämtern oder unzureichender Finanzierung, denn Bürgergeld ist reichlich verfügbar. Der Flaschenhals ist die Netzeinbindung. Mangelnde Anschlussmöglichkeiten sind aktuell unser größter limitierender Faktor bei neuen Vorhaben im Bereich Windkraft und Photovoltaik.“
Spagat zwischen Idealismus und Realität beim Klimaschutz
Während die Einspeisung von Solarstrom also ein wichtiger Baustein der Energiewende ist, bringt sie auch Herausforderungen mit sich. Eine steigende Einspeisung erfordert den Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze, um Schwankungen auszugleichen. Denn Solarstrom wird hauptsächlich tagsüber produziert, während der Verbrauch in den Abendstunden oft höher ist. Gibt es keine ausreichenden Speicherlösungen, kann es zu Netzüberlastungen oder Engpässen kommen. Sonnenreiche Zeiten erbringen eventuell einen Überschuss an Strom, den das Netz nicht immer aufnehmen kann.
Speichertechnologien wie Batteriesysteme sind notwendig, aber noch relativ teuer und ressourcenintensiv in der Herstellung. Ohne Speicher müsste jedoch der überschüssige Strom ins Netz eingespeist werden, anstatt für den Eigenverbrauch genutzt zu werden.
Die Lösung liegt also auf nationaler, beziehungsweise internationaler Ebene: Grenzüberschreitende Stromnetze in Europa könnten ein wichtiger Aspekt in der modernen Energieversorgung werden. Diese Netze verteilen Energie effizienter und erhöhen die Versorgungssicherheit. Durch die Integration verschiedener Energiequellen profitieren Länder von den Stärken ihrer Nachbarn, etwa durch den Austausch von Wind- und Solarenergie. Grenzüberschreitende Netze helfen außerdem, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und die Energieversorgung nachhaltiger zu gestalten. Dieses Vorgehen könnte maßgeblich zur Erreichung der europäischen Klimaziele und zur Schaffung eines stabilen und flexiblen Energiesystems beitragen.
So gut die Idee, so hoch auch die Hürden der Umsetzung: Neben zahlreichen technischen Herausforderungen, wie etwa die Inkompatibilität der Netzspannungen und Frequenzen zwischen den Ländern, gibt es unterschiedlichen Regulierungen und Energiemarktpolitiken. Außerdem sind hohe finanzielle Anforderungen nicht außer Acht zu lassen. Politische Stabilität und eine enge Zusammenarbeit zwischen den Ländern sind für den Erfolg grenzüberschreitender Stromnetze eine Voraussetzung.
Internationale Abkommen und ein koordiniertes Vorgehen sind unerlässlich, um diese Hindernisse zu überwinden. Von Regierungen über Unternehmen bis hin zu Bürgern müssen alle an einem Strang ziehen. Bürgerenergiegenossenschaften können jedoch im Kleinen ein Beispiel sein und die Energiezukunft im 21. Jahrhundert mitgestalten.
URL dieses Artikels:
https://www.schwetzinger-zeitung.de/wirtschaft_artikel,-regionale-wirtschaft-so-funktionieren-energiegenossenschaften-in-der-rhein-neckar-region-_arid,2308845.html
Links in diesem Artikel:
[1] https://www.schwetzinger-zeitung.de/orte/schwetzingen.html
[2] https://www.schwetzinger-zeitung.de/orte/oftersheim.html
[3] https://www.schwetzinger-zeitung.de/orte/ketsch.html
[4] https://www.schwetzinger-zeitung.de/orte/plankstadt.html