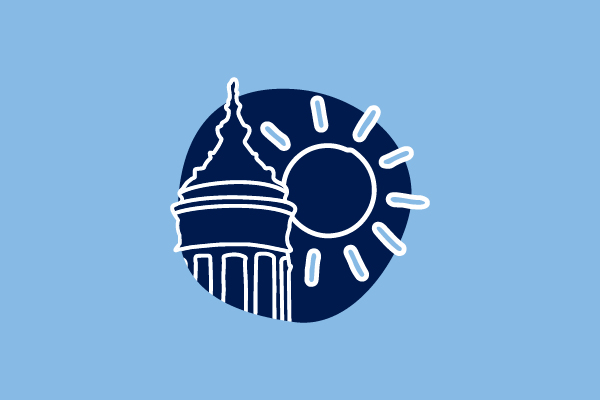Ludwigshafen. Es ist ein ungewöhnliches Motiv, das die Stadtväter antreibt. Mit rund 100.000 Einwohnern ist Ludwigshafen zwar die viertgrößte Stadt Bayerns, aber seit Ende des Ersten Weltkriegs französisch besetzt. Der Rhein dient als (Zoll-)Grenze, mit sehr begrenzten Brückenöffnungszeiten. Inflation und Arbeitslosigkeit plagen die Bürger. Da entsteht im Rathaus die Idee, einen Park anzulegen – als Wirtschaftsförderung, wie man es heute nennen würde.
Versumpftes Gebiet: Ebertpark entsteht im Bereich des ehemaligen Altrheins
Der Gedanken geht auf Albert Zwick zurück, Leiter des Statistischen Amtes von Ludwigshafen, der jedoch nicht nur Zahlen verwalten will. Er fügt seinem Amt eine Abteilung Wirtschaft an, um Handel und Wirtschaft anzukurbeln und Ludwigshafen zur Ausstellungsstadt zu machen. Dabei sollen auch Notstandsarbeiten helfen – also Arbeitslose. Eine Fläche dafür wird schnell ausersehen: ein versumpftes Gebiet im Bereich des ehemaligen Altrheins mit Schuttabladeplätzen und „Wasserlöchern“, wie die Bevölkerung das Areal zwischen Friesenheim und Oggersheim nennt, in dem viele Schnaken brüten.
In zahlreichen Sitzungen städtischer Gremien wird hinter verschlossenen Türen unter Leitung von Oberbürgermeister Christian Weiß 1924 der Beschluss gefasst. Danach will Ludwigshafen 1925 eine Süddeutsche Gartenbauausstellung, „SÜGA“ genannt, ausrichten – eine der ersten im deutschen Südwesten und Vorläuferin der heutigen Landesgartenschauen. Nur darum geht es zunächst – um ein Ausstellungs- und Messegelände. Der Park entsteht quasi als Nebeneffekt.
„Quertreibereien“ auf der Baustelle
Und er entsteht schnell: Im November 1924 gehen die Bauarbeiten los, auch eine Straßenbahnlinie wird gebaut. Für den Aushub werden eigens Maschinen beschafft, etwa ein großer Eimerbagger, acht Benzoltriebwagen und 78 Kippwagen, um 67.000 Kubikmeter Erdmasse wegzuschaffen sowie 123.200 Quadratmeter Fläche einzuebnen. Offenbar gibt es öfter Ärger auf der Baustelle. In Unterlagen des Stadtarchivs ist von „Quertreibereien“ und „Rädelsführern“ die Rede. Um den Eröffnungstermin am 28. Mai 1925 zu halten, wird ab 6. April sogar in zwei Schichten gearbeitet. Im April 1925 beschließen die Stadträte – gegen die Stimmen der Kommunisten – die Benennung des Geländes nach dem am 28. Februar 1925 verstorbenen, in Heidelberg geborenen ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik, Friedrich Ebert.
Fertig ist das Areal zur Eröffnung zwar nicht, dennoch jubelt der „Generalanzeiger“: „In 75 Tagen entstand aus dem Nichts eine zauberhafte vollendete Anlage“. Und Oberbürgermeister Weiß erklärt: „Keine Ausstellung ist fertig, das ist das Schicksal jeder Ausstellung“. Und da der erste Tag der Veranstaltungen gleich alle Erwartungen übertrifft, schreibt der „Generalanzeiger“ triumphierend: „Jetzt gehen wir nicht mehr nach Mannheim, jetzt kommt Mannheim nach Ludwigshafen“.
Erkennungszeichen der Ausstellung wird das goldschimmernde Standbild der Blumengöttin Flora auf der Spitze des Turmrestaurants, zur Eröffnungsfeier dargestellt von Fräulein Lillie vom Nationaltheater Mannheim. Vor dem Turmrestaurant entsteht der Sternbrunnen, dahinter ein Freilicht- und Gartentheater. Mehrere Ausstellungshallen werden gebaut, eine Schaubäckerei der Bäckerinnung, ein Pfälzer Weinhaus, eine Kapelle im Friedhofsgarten und ein Radio-Pavillon. Radio zu hören, das ist 1925 noch etwas Besonderes und in der linksrheinischen Pfalz der Besitz von „Funkempfängern“ von der Besatzungsmacht verboten. Im Radiopavillon darf man aber – mit Kopfhörern oder Lautsprechern – Sendungen verfolgen, sogar ausländische Sender hören. Dazu kommen viele Großveranstaltungen, das Pfälzische Sängerfest etwa und das Pfälzische Kreisturnfest mit großem Festumzug sowie viele Tanzabende und Kulturevents.
Nach der SÜGA beginnen die Arbeiten, um den Park dauerhaft zu nutzen
Im August 1925 wird angesichts von 300.000 Besuchern eine positive Zwischenbilanz gezogen. Die Presse lobt die Blütenpracht und die abendlichen Illuminationen des SÜGA-Geländes, während Mannheimer Besucher ungünstige Straßenbahnverbindungen beklagen. Zum SÜGA-Ende am 12. Oktober 1925 ist von 500.000 Besuchern die Rede - aber es wird auch ein Defizit beklagt von 350.000 Mark. Und es taucht die Frage auf, ob der Eintritt – eine Mark für Erwachsene – nicht zu hoch und die Ausgaben für Werbung nicht übertrieben gewesen seien. Plötzlich wird der SÜGA „liederliche Geschäftsführung“ vorgeworfen. Es kommt sogar zu Pfändungen von Ausstellungsinventar, um Gläubigerforderungen zu decken, und Verantwortliche der SÜGA-GmbH nehmen sich verzweifelt das Leben. Schließlich gelangt ein Ratsprotokoll zu dem Schluss, die – von der Stadt unabhängige – Ausstellungsgesellschaft habe „in künstlerischer Beziehung Glänzendes geleistet, während sie in finanzieller und verwaltungstechnischer Beziehung schwere Fehler begangen hat“. Dennoch entscheidet der Stadtrat mit knapper Mehrheit, die Ansprüche der Gläubiger zu befriedigen, damit der neue Park erhalten bleibt.
Gleich im ersten Winter nach der SÜGA beginnen Arbeiten, um den Park dauerhaft nutzen zu können, etwa durch die Beseitigung von Provisorien. Auch die Konzertmuschel entsteht. Aus der Grube für die Ausbaggerung des Ausstellungsgeländes wird der Schwanenteich. Sogar eine Erweiterung des Ebertparks plant die Stadt - auch mit dem Argument, das Grün könne für bessere Luft in der Stadt und bessere Lebensqualität in den oft engen Wohnquartieren führen. Immerhin wird im Sommer 1927 eine halbe Million Besucher gezählt, die Eintritt zahlen. Daher soll laut Beschluss von 1928 die frühere Ausstellungsfläche um einen Sportpark und einen weiteren Volkspark ergänzt werden, wenn auch langfristig. Aber das verhindert die Weltwirtschaftskrise 1929. Nur der Bau einer „Stillstube“ für junge Mütter erfolgt noch 1930.
In der Diktatur der Nationalsozialisten verliert der Ebertpark seinen Namen – Ebert war schließlich Sozialdemokrat. Die Nazis nutzen den Park in erster Linie für ihre Propagandaveranstaltungen, aber er soll auch weiter der Naherholung dienen. Daher werden Beete umgestaltet, ein Kakteengarten angelegt und 1935 ein Tiergehege geschaffen. Das entwickelt sich schnell zum Hauptanziehungspunkt, leben hier doch drei junge Braunbären und ein Malaienbär (auch Sonnenbär genannt). Weitere Pläne, etwa für ein Freilichttheater, fallen aber dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer. Und vermutlich auch die Bären. Es gibt Spekulationen, dass sie 1942 erlegt werden, damit sie nicht nach Luftangriffen aus einem womöglich zerstörten Gehege fliehen und Menschen gefährden können. Laut Stadtarchiv Ludwigshafen gibt es aber keine Unterlagen zum Verbleib der Bären.
Ebertpark: Tipps für Besucher
Anschrift: Ebertpark, Erzbergerstraße 69/Haupteingang Herbert-Müller-Platz, 67063 Ludwigshafen
Anfahrt: Stadtbahn Linie 7 Richtung Friesenheim bis Haltestelle Ebertpark, viele Parkplätze an der Eberthalle.
Programm: Ab dem 17. Mai 2025 sind unter dem Motto „100 Jahre Ebertpark – 100 Tage Ebertpark“ zahlreiche Veranstaltungen geplant. Dazu gehören Offener Boule-Spieltag, Kursangebot Zeichnen und Aquarellieren im Ebertpark, Sport im Park sowie verschiedene Angebote in der Konzertmuschel. Details kurz vorher unter www.ludwigshafen.de.
Souvenirs : zum Jubiläum einen Ebertpark-Kalender und ein -Dubbeglas aufgelegt, die in der Tourist-Information, im Turmrestaurant und im BASF-Weinkeller angeboten werden. pwr
Nach dem Zweiten Weltkrieg, der in Ludwigshafen schon Ende März 1945 mit dem Einmarsch der Amerikaner endet, bekommt der Ebertpark gleich seinen alten Namen wieder. Die Ausstellungshalle und die beiden Kioske am Sternenbrunnen sind zwar durch Luftangriffe zerstört, aber andere Gebäude sowie weite Teile der Grünflächen erhalten. Sie dienen nun – angesichts des grassierenden Hungers – dem Anbau von Gemüse, um vor allem das Städtische Krankenhaus und Volksküchen zu versorgen. Erst nach der Währungsreform 1948 geht die Stadt langsam daran, ihn wieder als Park zu gestalten. Pfingsten 1950 kann dann schon wieder groß gefeiert werden: „Auftakt im Ebertpark“ heißt das große Fest.
Ab 1952 wird der reparierte Sternbrunnen sogar bunt beleuchtet. Darauf folgen zahlreiche Erweiterungen – 1954 der Waldstaudengarten, 1956 ein Sommerblumengarten, 1958 ein Lesegarten, 1959 Vogelvolieren und Kleintiere, 1961 Volieren für Greifvögel und 1962 der Kinderzoo. 1965 entsteht die Eberthalle als große Veranstaltungshalle, im Jahr darauf der Quellgarten mit vielen Wasserbecken und Fontänen. 1977 erwirbt der Miniatur-Golf-Club die Minigolfanlage, baut 1984 anstelle des Gartenschachs ein Vereinshaus mit Kiosk.
Die Tiergehege sind leer oder ganz verschwunden
Mehrfach hofft Ludwigshafen, im Ebertpark eine Landesgartenschau ausrichten zu dürfen - und so Auftrieb und Zuschüsse für Erweiterungen zu bekommen. Zunächst finden solche Veranstaltungen aber in Rheinland-Pfalz (im Gegensatz zu Baden-Württemberg und Bayern) gar nicht statt. 2000 wird, als Rheinland-Pfalz sich doch zu solchen sommerlangen Festen entschließt, indes erst Kaiserslautern und dann für 2004 Trier der Zuschlag gegeben.
Für den Ebertpark bedeutet das einen Rückschlag. Inzwischen hat sich aber ein Förderkreis gebildet. Die Konzertmuschel ist 2011, das Turmrestaurant 2009 saniert und erst 2025 nochmal renoviert und neu verpachtet worden. Schließlich stehen das Turmrestaurant und der gesamte historische Bereich des Ebertparks mit Sternbrunnen, den pavillonartigen Kioskhäuschen und der Konzertmuschel unter Denkmalschutz. Das gilt ebenso für die Bronzeskulptur des Bogenschützen, 1895 von dem Berliner Künstler Ernst Moritz Geyger geschaffen und neben dem Turmrestaurant Wahrzeichen des Ebertparks.
Doch trotz gut gepflegter Wege, Spielplätze und Wiesen, wofür den zwölf Mitarbeitern der Stadt ein Budget in Höhe von einer Million Euro zur Verfügung steht, merkt man den Sparkurs der Stadt. Die Staudenpflanzungen sind zwar mehrfach prämiert worden. Im einstigen Quellgarten sind indes alle Becken leer und kaputt, der Rosengarten heruntergekommen und alle Tiergehege verwaist oder schon abgebaut. 2022, nach mehreren Fällen von Vandalismus, sind die zuletzt 100 Ponys, Schafe, Ziegen, Kaninchen, Fasanen und Sittiche in den Wildpark Rheingönheim gekommen.
URL dieses Artikels:
https://www.schwetzinger-zeitung.de/leben_artikel,-zeitreise-vom-altrheinarm-zum-park-100-jahre-ebertpark-in-ludwigshafen-_arid,2301790.html